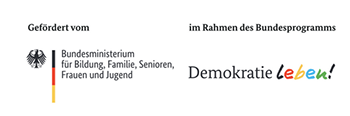NARUD-Intervention – „Afrika ist kein Testlabor“
NARUD-Intervention – „Afrika ist kein Testlabor“ – 28-4-2020 als PDF
Kontinuitäten von Kolonialismus und Rassismus im europäischen Blick auf Afrika in der Corona-Krise
„Afrika ist kein Testlabor“, twitterte Didier Drogba, nachdem sich am 1. April sich auf dem französischen Fernsehsender LCI zwei Mediziner darüber ausgetauscht hatten, dass Impfstoffe gegen Corona doch prima in Afrika getestet werden könnten. Der Fußballstar von der Elfenbeinküste war nur eine von vielen Stimmen einer schnell entfachten Empörungswelle, mit der sich die lebendigen afrikanischen Zivilgesellschaften sowie die afrikanischen Diasporen in Europa zur Wort meldeten und die Kontinuitäten von Kolonialismus und Rassismus anklagten, wie sie sich einmal mehr im Gespräch der beiden französischen Forscher geäußert hatten.
Jean-Paul Mira, Chefarzt an einem auch in der Forschung engagierten Pariser Krankenhaus, hatte in einer TV-Talkshow Camille Locht, Forschungsdirektor eines staatlichen Instituts, das für das Gesundheitsministerium zu einem Impfstoff gegen das Coronavirus forscht, gefragt: „Wenn ich provokativ sein würde – sollten wir diese Studie nicht auch in Afrika durchführen, wo es keine Masken, keine Behandlungen, keine Wiederbelebungsmethoden gibt?… So wie es auch bei einigen Studien zu Aids gemacht wurde. Bei Prostituierten kann man experimentieren, weil man weiß, dass sie besonders exponiert sind und sich nicht schützen.” Damit bezog er sich auf HIV-Impfversuche, die an Prostituierten in Uganda und Südafrika durchgeführt worden waren. Der Forscher antwortete: “Sie haben recht, wir überlegen, eine parallele Studie in Afrika durchzuführen.“
Erst der schnell über die beiden in alter Kolonialherrenmentalität über Afrika parlierenden TV-Experten hereinbrechende Shitstorm musste sie belehren, dass Afrikaner*innen selbst dazu auch etwas zu sagen haben und dies sich in Zeiten globalisierter Social Media-Öffentlichkeiten auch schnell verbreitet: Kaum hatte der kenianische Blogger Bravin Yuri kommentiert: „Afrika hat die geringsten Zahlen von Covid-19-Infektionen und Toten weltweit. Und dennoch wollt ihr Impftests in Afrika einführen, als wären wir Laborratten“, da entstand auch schon der Twitter-Hashtag #AfricansAreNotLabRats. Dort war z.B. zu lesen: „Wenn in Paris Bomben gezündet werden, zeigen wir alle Solidarität, obwohl sie umgekehrt Afrikaner nicht als Menschen betrachten.“ Die Anti-Rassismus-Gruppe SOS Racisme forderte schließlich Frankreichs Medienaufsichtsbehörde auf, die Äußerungen formell zu verurteilen, was jedoch nicht geschah. Stattdessen wanden sich die beiden Mediziner zwischen Entschuldigungen und Erklärungen, sie seien missverstanden worden, hin und her.
Koloniale Kontinuitäten bei Impf- und Medikamententests in Afrika
Doch die Sensibilität bei diesem Thema für die Kontinuitäten von Kolonialismus und Rassismus, die in vielen empörten Kommentaren zum Ausdruck gebracht wurde, ist leider allzu berechtigt – und nicht nur auf Frankreich bezogen. Derzeit hören wir in Deutschland ja fast täglich vom Robert-Koch-Institut. Doch wie wirkte der Namensgeber in Afrika? Robert Koch erforschte auf zwei Expeditionen Mittel gegen die Schlafkrankheit. Dies war eingebunden in die Aufgabe der Medizin im Kolonialismus, Gesundheitsfürsorge für Siedler, Kolonialbeamte und Militärs zu leisten und die Kolonien rentabel zu machen, indem man die Arbeitskraft der Kolonialuntertanen erhält. Dafür war Koch bereit, Mittel an Afrikaner*innen zu testen, deren schwere Nebenwirkungen bekannt waren. Zwar infizierte der Nobelpreisträger wohl nicht bewusst seine afrikanischen Versuchspersonen. Dies unterschied seine Tests noch von den späteren Menschenversuchen nationalsozialistischer Mediziner in deutschen KZs. Doch die billigend in Kauf genommenen Nebenwirkungen bei bereits Erkrankten waren sehr schmerzhaft, dennoch wurden hohe Dosen verabreicht, die sogar oft zu Erblindungen der Testpersonen führten. Außerdem wurde die Medizin zwangsweise verabreicht, wie der Kolonialismus-Experte Jürgen Zimmerer in einem Interview mit der Welt darstellte: „Dass die Kolonialherrschaft die Afrikanerinnen und Afrikaner nicht schützte, darin lag auf jeden Fall Rassismus.“ Denn solche Tests wären auch damals kaum in Deutschland an weißen Deutschen vollziehbar gewesen.
Dieses Beispiel ist leider kein Einzelfall und solche Praxen waren nicht nur auf die deutschen Kolonien und die Zeit der direkten Kolonialherrschaft begrenzt. Eine aktuelle Studie weist z.B. unethische klinische Versuche in den vier afrikanischen Ländern Ägypten, Kenia, Zimbabwe und Südafrika nach. Afrikaner*innen haben also allen Grund, höchst misstrauisch zu sein. Insbesondere, da sie in vielen autoritär regierten Ländern auch nicht ihren oft korrupten Regierungen trauen können, die meist ohne tatsächliche Dekolonisierung die schwachen kolonialen Institutionengefüge weitgehend übernommen haben, wodurch aus dem Kolonialismus stammende Abhängigkeiten bis heute reproduziert werden und Wertströme per saldo immer noch von Afrika in den globalen Norden fließen.
Afrika widerspricht in der Corona-Krise dem europäischen Blick auf Afrika
Afrika darf aber auch nicht auf Korruption, unfähige und schwache Regierungen und Elend reduziert werden. Der vielfache Aufschrei aus hoch sensiblen afrikanischen Zivilgesellschaften und Diasporen könnte Europäer*innen auch zeigen, dass in den meisten afrikanischen Ländern sehr lebendige, aktive und widerstandsfähige Zivilgesellschaften entstanden sind, die nicht bereit sind, alles mit sich machen zu lassen. Und sie sind erfahren darin, Aufgaben zu übernehmen, wo Regierungen versagen, wie die Aufstände im Sudan mit starkem Protagonismus von Frauen und der Jugend zeigen. Vielmehr sollten Europäer*innen ihre eigenen Regierungen fragen, weswegen sie in vielen afrikanischen Ländern weiterhin korrupte Eliten unterstützen, die in ihrem Land erwirtschaftete sowie aus der Entwicklungszusammenarbeit bezogene Gelder über entwicklungshemmende ökonomische Regime der Enteignung wieder in den Werttransfer in den globalen Norden umleiten, während z. B. öffentliche Gesundheitssysteme vernachlässigt werden.
Doch trotz dieser Schwierigkeiten muss zunächst festgehalten werden, dass die afrikanischen Länder bislang sehr erfolgreich die Ausbreitung der Corona-Pandemie auf ihrem Kontinent verhindert haben. Zum Beispiel haben afrikanische Länder sehr schnell ihre Grenzen für die Einreisen von Europäer*innen geschlossen. Zwar ist der afrikanische Kontinent besonders verwundbar: Während das Verhältnis von Ärzt*innen zu Menschen in Europa durchschnittlich bei 1:300 liegt, kommen in Subsahara-Afrika etwa 5.000 Menschen auf eine*n Ärzt*in. Selbst Südafrika, in dem es ein halbwegs ausgebautes Gesundheitswesen gibt, verfügt nur über 3.000 Intensivbetten. Die Millionen Menschen, die in Elendsquartieren der Megastädte leben müssen oder gar in den vielen Flüchtlingslagern, haben wenig Möglichkeiten, Social Distancing einzuhalten.
Doch die afrikanischen Bevölkerungen wie auch ihre Regierungen haben viel Erfahrung im Umgang mit Epidemien und Katastrophen. Die jüngst relativ schnelle „Eindämmung von Ebola deutet auf ein effizientes Krisenmanagement in Staaten hin, die mit einem Bruchteil der Ressourcen arbeiten, die den Ländern des Westens zur Verfügung stehen. Und diese Eindämmung kam nicht vom Däumchendrehen”, wie Paul Dziedzic in der Analyse & Kritik bemerkte.
Als die Pandemie sich von China aus zu verbreiten begann, waren die westlichen Medien voll von Prophezeiungen, dass als nächstes Afrika besonders schlimm betroffen sein werde. Der bislang nicht als Afrika-Experte aufgefallene neue Star-Virologe Christian Drosten warnte im Stern: „Die Menschen werden auf den Straßen sterben.“ Wie selbstverständlich wurde angenommen, dass Afrika nichts hinkriegen würde. Ebenso selbstverständlich scheint, wenn es um Afrika geht, dass jede*r mitreden kann und ‚Afrika‘ anscheinend ein einziges großes, unterschiedsloses Land sei. Doch die Bilder von überlasteten Krankenhäusern kamen bald aus Europa und den USA, die Horrormeldungen von zur Triage gezwungenen Ärzt*innen aus Italien und Spanien. Während der Britische Premierminister Boris Johnson und der US Präsident Donald Trump noch die „Grippe“ verharmlosten und wichtige Zeit zur Eindämmung verstreichen ließen, was ihre Länder mit vielen Toten (vor allem unter der armen, überproportional Schwarzen und Braunen Bevölkerung) bezahlen mussten, reagierten die afrikanischen Länder sehr schnell mit strikten Einreisestopps und entschiedenen Maßnahmen trotz bislang sehr wenig Erkrankten auf dem afrikanischen Kontinent.
In Afrika scheint bis jetzt also einiges richtig gemacht worden zu sein, denn Corona verbreitete sich hier bislang viel langsamer als in Europa und den USA.
Doch wo blieben nun die anerkennenden Berichte in den westlichen Medien? Wäre es nicht an der Zeit, nun einmal differenzierter auf afrikanische Länder zu schauen und zu fragen: Was habt ihr richtig gemacht? Was können wir in Europa von eurer Erfahrung im Eindämmen von Epidemien lernen?
Doch positive Berichterstattung aus Afrika ist auch jetzt nirgendwo in den Massenmedien des Westens zu finden. Der rassistische, aus dem Kolonialismus stammende Blick, dass Afrika selbst nichts hinkriegt, ist dafür zu festgefahren. Die Stereotypen, mit denen in Afrika nur Elend und Korruption wahrgenommen werden, sind nicht nur eine gut verkäufliche Ware – Paul Dziedzic spricht von „Misery Porn“ – sie reproduzieren auch rassistische Ideologien: Die dauernde Wiederholung des immer gleichen Elends naturalisiert die weltweiten Ungleichheiten, und im schönen Schaudern über das gruselige Elend weit weg, nehmen die europäischen Subjekte sich selbstbestätigend als überlegen war. Da kann man sich sagen, uns geht’s doch noch gut, und damit die Hegemonie westlicher Gesellschaftssysteme und Regime bestätigen.
Diese Selbstbestätigungen lassen die eigenen Selbstbilder intakt, während sich auch im Westen die durch neoliberale Sparpolitiken arg angegriffenen Gesundheitssysteme angesichts der Pandemie als weitaus weniger intakt erweisen und die Sterblichkeitsraten in den Ländern besonders hoch sind, wo es in den letzten Jahren die meisten angeblich notwendigen Austeritätsprogramme oft Hand in Hand mit einer schleichenden Privatisierung des Gesundheitssektors gab.
Bilder von nigerianischen Ärzt*innen, die stolz vom erfolgreichen, im Umgang mit Epidemien erfahrungsgesättigten und durch eindrucksvolle Statistiken bestätigten Maßnahmenplan ihres Landes berichten, von dem Europa und die USA durchaus lernen könnten, würden diesen gewohnten und pauschalen Blick des Westens auf Afrika ebenso stören, wie Berichte über die vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen, die in den meisten Ländern offenbar nicht unwirksame Aufklärungskampagnen starteten, oder gar über die Wissenschaftler*innen am Institut Pasteur in Dakar (Senegal), die an einem Corvid19-Schnelltest arbeiten, der das Ergebnis in nur zehn Minuten liefern, nur einen US-Dollar kosten und auf dem ganzen Kontinent verteilt werden soll. Durchaus existierende Sicherheitsbestimmungen werden in fast allen Ländern Afrikas rund um die Uhr über TV, Radio und Social Media verbreitet, Regierungen ergreifen Maßnahmen und wo sie nicht greifen, werden sie von Initiativen aus den Zivilgesellschaften angepasst und ergänzt. Jedoch gibt es auch zurückzuweisende repressive Maßnahmen gegen die Zivilbevölkerungen, wie z.B. in Kenia, wo es Anfang April mehrere Todesopfer durch Polizeigewalt inkl. Anwendung scharfer Munition gab. Während sich die deutsche Regierung dagegen sträubt, europäische Verantwortung mit gemeinsamen Euro-Bonds zur Minderung der ökonomischen Krisenfolgen zu übernehmen, bereitet die Regierung Ruandas Hilfen für andere afrikanische Länder vor, wenn diese Maßnahme auch von politischem Kalkül mitbestimmt ist.
Ja, es stimmt, afrikanische Länder sind besonders verwundbar und die Schlacht gegen die Epidemie ist auch in Afrika noch nicht geschlagen. Bei der enormen Bandbreite an besseren und schlechteren sozio-ökonomischen Bedingungen in afrikanischen Ländern und der enormen Größe des Kontinents ist schon davon auszugehen, dass es regional noch zu schlimmen Ausbrüchen kommen könnte. Aber die kolonialistische Annahme, Menschen auf den Straßen sterben zu lassen, hat wenig mit den Verhältnissen vor Ort zu tun. Dazu ist man auch in Afrika genau so wenig bereit, wie sich als „Laborratten“ missbrauchen zu lassen.
Die Krise als Chance?
Während kubanische Ärzt*innen Italien, Spanien und Frankreich solidarisch zu Hilfe eilen, um die schlimmen Folgen marode gesparter Gesundheitssysteme etwas zu lindern; während überproportional viele Menschen der afrikanischen Diasporen in den Krankenhäusern Europas überproportional prekär beschäftigt und miserabel bezahlt ihre Gesundheit riskieren, können sich Afrikaner*innen nun anschauen, wie Europa sich in der Krise das genehmigt, was afrikanischen Ländern auch in Situationen von Epidemien und Katastrophen immer im westlich dominierten internationale Finanzgefüge verwehrt wurde: Zwänge zur Schuldenrückzahlung oder Schuldenbremsen werden aufgegeben, ganze Industrien und Handelssektoren schuldenfinanziert gerettet, private Krankenhäuser in Spanien verstaatlicht oder wie in Italien unter staatliche Planung gestellt oder sogar Industriezweige vom Staat mit Produktionsquoten zur Herstellung in der Krise nötiger Produkte gezwungen.
Wie schon in der Krise nach den Bankenzusammenbrüchen in den USA 2008, die sich auf viele afrikanische Länder besonders verheerend und lange anhaltend auswirkte, muss nun erneut die kapitalistische Weltwirtschaft mit nicht-marktwirtschaftlichen Mitteln gerettet werden. Wird dies zu einer Abkehr von dem neoliberalen Universalpatentrezept – mehr Markt! – führen? Leider muss es skeptisch machen, wie schnell nach den Rettungsaktionen in der Krise 2008 wieder zum neoliberalen business as usual übergegangen wurde und wie damals die afrikanischen Länder mit den Krisenfolgen allein gelassen wurden. Es ist zu befürchten, dass ein globaler Norden, der selbst mit langanhaltenden ökonomischen und sozialen Krisenfolgen zu kämpfen haben wird, sich erst recht in seiner Selbstbezüglichkeit einrichtet, in dem Afrika immer noch weitgehend nur als kolonial geprägtes ideologisches Gegenbild vorkommt.
Dabei könnte die Krise auch zeigen, dass Weltprobleme wie Pandemien und die ökologische Krise nur international und solidarisch gelöst werden können. Dort hingegen, wo extreme Rechtspopulisten wie Trump, Bolsonaro oder Salvini regieren, versagt das Krisenmanagement. So hatte die Partei Lega Nord Salvini in ihren besonders schlimm von der Pandemie betroffenen Hochburgen in Norditalien den privaten Gesundheitssektor jahrelang gehätschelt, den öffentlichen völlig vernachlässigt. Der Privatsektor stellt dort aber nicht einmal 8% der Intensivbetten. Deswegen müssen Ärzt*innen dort nun viele Schwerkranke dem sicheren Sterben überlassen. Dort zeigt sich nun nicht mehr nur vom Rassismus besonders betroffenen Menschen: Rechtspopulismus ist buchstäblich lebensgefährlich!
Entscheidend wird jedoch sein, ob die demokratischen Gegenkräfte glaubwürdige und hegemoniefähige Anti-Krisenpolitiken entwickeln, die mit den notwendigen Transformationsperspektiven zu einer nachhaltigen Entwicklung verbunden sind. Damit muss jetzt dringend begonnen werden. Die afrikanischen Zivilgesellschaften und Diasporen sollten als Expert*innen auf nicht-paternalistische Weise einbezogen sein. Sonst gibt es die nächsten deutlichen und verdienten Wortmeldungen – wie im „Afrika ist kein Testlabor“-Shitstorm!